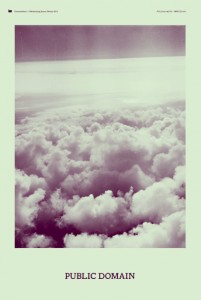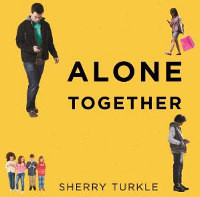Es gibt Texte, die sind gut leserlich und mit anschaulichem Material versehen. Trotzdem fragt man sich nach einem Dutzend Seiten, ob Autor oder Leser oder beide wirklich checken, was ausgesagt respektive verstanden werden soll. So ergeht es mir etwas mit dem Text „Information Wants to Be Shared“ von Joshua Ganz.
Es gibt Texte, die sind gut leserlich und mit anschaulichem Material versehen. Trotzdem fragt man sich nach einem Dutzend Seiten, ob Autor oder Leser oder beide wirklich checken, was ausgesagt respektive verstanden werden soll. So ergeht es mir etwas mit dem Text „Information Wants to Be Shared“ von Joshua Ganz.
Dem Autor geht es um Verteilprozesse von Information, die er aus ökonomischer Perspektive analysieren möchte. Er stellt zu Recht fest, dass Information nur in dem Mass relevant und wirksam wird, wie sie verteilt wird. Der Autor nimmt die Preisbildung in den Blick. Er konstatiert im Einklang mit der allgemeinen Wahrnehmung und mit Steve Wozniak in den achtziger Jahren, dass die Verteilung von Information immer günstiger wird. Autor Ganz versucht, den daraus folgenden Wandel des Informationsmarktes und die Auswirkungen auf die Vertriebsindustrie zu skizzieren. Gelingt das?
Ein Problem: Der Informationsbegriff wird weder geklärt noch differenziert. Joshua Ganz scheint davon auszugehen, dass Informationen im Allgemeinen marktfähig seien. Das leuchtet nicht ein. Grosse Segmente von Informationen gehören persönlicher Kommunikation oder banalen betrieblichen Abläufen an. Niemand will die haben – und schon gar nicht dafür bezahlen. Die meisten Formen von Informationen flottieren einfach in der Gesellschaft herum. Potentiell marktgängig ist Information in moderner Gesellschaft allenfalls, wenn sie als Werk geformt ist. Und auch dann müssen noch verschiedene weitere Bedingungen erfüllt sein. Die Myriaden von Flickr-Fotos oder Schulband-Songs sind werkartige Bausteine der alltagskulturellen Kommunikation – von Marktgängigkeit sind die aber weit entfernt.
Dem würde der Autor wahrscheinlich nicht widersprechen. Ist es dann aber angebracht, so allgemein von Information und Markt zu reden?
Der Autor nennt es immer Information, in manchen Zusammenhängen meint er aber Werke. Im Titel spricht er aber offenbar und meint offenbar ganz allgemein Informationen. Die Lesenden haben lebhaft diskutiert, wie der Titel zu interpretieren sei. Eine Möglichkeit ist, „Information will…“ metaphorisch zu verwenden, dann aber ein ausformuliertes Konzept auszubreiten, das die Rolle sozialer Akteure erläutert oder die Forderung nach optimalem Informationsfluss untermauert. Der Autor scheint die metaphorische Formulierung jedoch ziemlich wörtlich zu nehmen. Wenn Information wirklich „will“, wird sie zum handelnden Akteur hoch stilisiert. Eine eher abenteuerliche Vorstellung. Vermutlich will Information gar nichts. Und ob sie wirklich geteilt werden kann, wäre zu diskutieren. Sicher kann sie nicht so geteilt werden, wie der heilige Martin seinen Mantel teilte, um die Hälfte einem Bettler zu geben.
Joshua Ganz vertritt die These, dass die KonsumentInnen eigentlich immer schon nur das Medium bezahlt hätten, nicht die Information. Etwas plausibler erscheint die Vermutung, dass der Käufer eines Krimis Taschenbuchform für einen Verbund von Medium und Content gezahlt hat. Wobei heute wie in den vergangenen Jahrhunderten immer die Medienhersteller den Löwenanteil der Erträge abschöpft haben – den Contentproduzenten blieben und bleiben Peanuts.
Mit seiner Behauptung, dass im Prinzip nur das Medium marktfähig ist, stützt der Autor einen Diskurs, der die wirtschaftlichen Anspruche der Inhaltsproduktion wegdefiniert und nur die technischen Infrastrukturen und Services wirklich abgelten will. Die ICT-Branche dürfte kaum widersprechen. Sie setzte 2012 rund 3‘000 Milliarden Franken um. Damit sind wir bei realer Ökonomie angelangt. Bei Geldflüssen, Branchen, Interessen und Verteilkämpfen. Diese Aspekte bleiben ausgeblendet, was dem Text eine gewisse Abgehobenheit verleiht.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht und hoffen, dass der Text in der nächsten Folge zum Kontrast eine wohlmeinendere Besprechung erhält.
Joshua Ganz: Information Wants to Be Shared. Harvard Business Review Press, Boston, Masschusetts. Blog dazu.