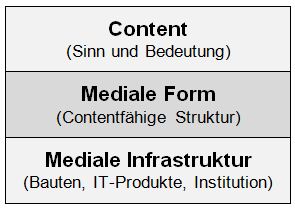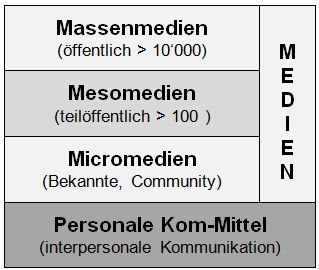Am 19. September hat die Lesegruppe der Digitalen Allmend die neue Saison eröffnet. Wir beschäftigen uns mit Medientheorien und besprechen das entsprechende Buch von Dieter Mersch (1).
Mersch betont die Vielgliedrigkeit und schwere Fassbarkeit des Medienbegriffs. Die Vielgliedrigkeit rührt daher, dass ganz verschiedene Stränge in den Begriff eingegangen sind. Als die wichtigsten identifiziert Mersch die Wahrnehmungstheorie seit der Antike, die Sprachtheorie des 18. Jahrhunderts und die Kommunikationstechnologien seit dem 19. Jahrhundert. Die Betrachtung von Kommunikationsmedien setzt also relativ spät ein: mit der Sprachtheorie. Die Reflexion der Massenmedien beginnt mit deren Durchbruch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Erst jetzt wird der Medienbegriff im Alltagsgebrauch darauf gerichtet. Noch um 1900 dachten die meisten Menschen beim Medium an eine spiritistische Sitzung.
Mersch betont die Negativität des Medienbegriffs. Weil es sich um eine Instanz der Vermittlung, des Dazwischen handelt, „kann es nicht positiv modelliert werden“ (S. 17). Hier wird in der Diskussion Kritik an der Absolutheit des Postulats laut: Wenn das gesellschaftliche Umfeld und die Akteure charakterisiert werden können, kann auch das Medium entsprechend gefasst werden. Anhand etwa des Begriffs der Mobilität überlegen wir, dass auch andere Konzepte lösgelöst von Zeit und Umständen nicht hinreichend beschrieben werden können.
In der Antike prägt Aristoteles den Medienbegriff als physikalisches Kozept. Beim Sehen braucht es ein Drittes, das dem Auge das Sehen eines Gegenstandes erlaubt. Dieses Notwendige ist aber nicht fassbar, es ist transparent und konturlos, eine Art eigenschaftsloser Zwischenraum. Das Medium besänftigt so auch die Angst vor dem Nichts, den horror vacui. Noch lange werden sich die Menschen im allgemeinen und die Wissenschafter im speziellen nicht vorstellen können, das sich im Nichts etwas fortbewegen kann. Als im 18. Jahrhundert Magnetismus und Schwerkraft intensiv diskutiert werden, lebt die Vorstellung des zwischenräumlichen Mediums erneut auf.
Bereits im 17. Jahrhundert erlebt die Medienthematik einen Aufschwung. Das Interesse an Optik und Akustik bringt die Frage nach Transportmedien für Licht und Schall aufs Tapet.
Die Romantik bringt eine radikale Verschiebung. Das Konzept des Mediums wird in die Kunstbetrachtung eingebracht. Medien sind in einem Kontext der Produktion Elemente der Ermöglichung. Medien ermöglichen die Hervorbringung von Abbildern. Weil diese Abbilder produziert sind und nicht einfach eine Kopie des Abgebildeten darstellen, bergen Medien das Potential der Entfremdung und Täuschung. Damit setzt eine negative Bewertung des Medialen ein die dem Begriff bis heute anhängt.
Sie scheint auch in der aktuellen Web 2.0 Diskussion auf, wenn den (verfälschten) institutionalisierten Massenmedien eine (ursprüngliche, unmittelbare) Medienszene von Citizen JournalistInnen und Bloggern gegenübergestellt wird.
Die Entwicklung der Nachrichtenübertragung, die im 19. Jahrhundert mit dem Telegraphen einsetzt, bewirkt eine neuerliche Verschiebung der Wahrnehmung des Medialen. Es erscheint ein neuer Bedeutungsstrang. Das Ökosystem der Zeichen wird mathematisiert und technisiert. Das Medium wird kybernetisch – zum Kanal für den reibungslosen Fluss der Signale.
* * *
Nach den ersten paar Dutzend Seiten hinterlässt das Buch einen ausgezeichneten Eindruck. Knapp und doch verständlich werden Entwicklungslinien und die Vielfalt der Einflüsse ins Licht gerückt.
1) Dieter Mersch. Medientheorien zur Einführung. Junius. Hamburg 2006.